-
‣9. Oktober 2009, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 149: SCHWARZER KIES (BRD 1961, R: Helmut Käutner), ungekürzte Premierenfassung – W 149 Infopapier.pdf – Film noir im Hunsrück. In "Schwarzer Kies" gibt Helmut Käutner ein Zeitbild der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Am Rande einer amerikanischen Militärbasis treffen Menschen aufeinander, die mit ihren Lebensentwürfen gescheitert sind. Der Lastwagenbesitzer Robert Neidhardt fährt heimlich illegale Kiesfuhren und lebt in den Tag hinein. Eines Tages taucht seine alte Liebe, nun die Frau des neuen amerikanischen Kommandanten, in dem kleinen Ort auf... – In seinem Film greift Käutner in einer Nebenhandlung den immer noch existierenden deutschen Antisemitismus an. Ein jüdischer Barbesitzer, ehemaliger KZ-Häftling, wird als "Saujude" beschimpft. Anlässlich der Filmpremiere kommt es zum Skandal. Der Zentralrat der Juden protestiert, reicht Strafantrag ein, Käutner wehrt sich, der Verleih zieht den Film zurück. „Daß der Zentralrat der Juden so empfindlich reagierte, ist also nicht nur ein 'unseliges Mißverständnis', wie Produzent und Regisseur rasch replizierten. Diese Antwort verkennt die erhöhte Verwundbarkeit der Betroffenen gerade zum gegenwärtigen Zeitpunkt, da ein deutscher Massenmörder in Jerusalem vor Gericht steht. Gerade jetzt ist die Atmosphäre zu sehr belastet, als daß die Bemerkung 'Du Saujud' (deren öffentliche Wiederholung jedes deutsche Gericht heute ahnen wird) unbeanstandet von der Leinwand schallen könnte." (Süddeutsche Zeitung, 20.4.1961). Käutner schneidet alle Szenen mit jüdischem Bezug heraus und mildert auch den dunklen Schluss ab. Es läuft die von mir wiederentdeckte ungeschnittene Premierenfassung.
-
‣2. Oktober 2009, Deutsche Kinemathek, 10.00 Uhr. Interne Vorführung von NIEMANDSLAND (D 1931, Victor Trivas) in verschiedenen Fassungen
-
‣15. September 2009, 20.00 Uhr + 18. September 2009, 19.00 Uhr: ANIMAHISTORY, Zeughauskino
-
‣14. September 2009, 19.00, Arsenal 2: FilmDokument 116: Jahresschau Deutscher Arbeit, Dresden 1928: Die Ausstellung "Die technische Stadt" – FD 116 Die technische Stadt 1928.pdf – Die Ausstellung "Die Technische Stadt" im Sommer 1928 in Dresden zeigt am Beispiel einer modernen Stadt, wie die Technik in das Leben der Menschen eingreift. Ausgestellt wird der technische Körper der Stadt, ihr Organismus: Elektrizität, Gas, Wasser, Verkehr und Nachrichtenwesen, Polizei und Feuerwehr. Das Programm bündelt sämtliche erhaltene Filme und Filmfragmente über die ambitionierte Schau. Die Sensation der Ausstellung ist DAS ERSTE KUGELHAUS DER WELT (1928). Auch DAS STAHLRAHMENHAUS DER STAHLBAU-GMBH DÜSSELDORF (1928) erregt Aufmerksamkeit. Ergänzend zeigen wir einen Werbefilm über den ZEITGEMÄßEN HAUSHALT (1930) sowie den ersten Dokumentarfilm über den Berliner Funkturm als DAS NEUE WAHRZEICHEN BERLINS (1928).
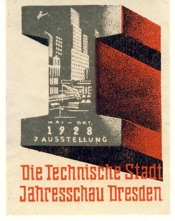
-
‣16. Juli 2009, Zeughauskino, 20.00 Uhr: Kunst des Dokuments - Architektur: DIE NEUE WELT (BRD 1954, R: Curt Oertel)
-
‣10. Juli 2009, Filmmuseum Potsdam, 18.00 Uhr: Kaffee, Kapok und Klischees: Die ehemalige Kolonie Deutsch-Ostafrika im Film / 20.30 Uhr: BAGA MOYO (D 1994). Infos hier!
-
‣25. Juni 2009, Weimar, Kommunales Kino mon ami, 19.30 Uhr. Rekonstruktion des Filmprogramms, das zur Eröffnung des Bauhauses in Dessau 1925 gezeigt wurde: Aufbruch ins flimmernde Licht
-
‣8. Juni 2009, Arsenal, Reihe FilmDokument, 19.00 Uhr: Licht, Luft und Sonne – Filme der 1920er Jahre über gesundes und wirtschaftliches Wohnen
-
‣24. April 2009, Kommunales Kino mon ami, Weimar: Studientage Bauaus & Film. Vortrag über den Film der Humboldt-Film GmbH WIE WOHNEN WIR GESUND UND WIRTSCHAFTLICH? (1926-28)
-
‣20. April 2009, Arsenal, Reihe FilmDokument, 19.00 Uhr: Mit Kajak und Kinamo: Die Anfänge von 'Hitlers Kameramann' Walter Frentz
-
‣1. April 2009, Zeughauskino, 20.00 Uhr: Einführung zu MENSCHEN AM SONNTAG (1930)
-
‣6. Februar 2009, Zeughauskino, 18.30 Uhr, Reihe Wiederentdeckt,Nr. 140: DIE VAMPIRE VON NEW YORK (Österreich 1921) – W 140 Die Vampire von New York.pdf – "Die Huronen sind eine brasilianische Marderart, die wegen ihrer Raubgier und Wildheit allgemein gefürchtet ist. Nach dieser Marderart wird eine berüchtigte Verbrecherbande benannt, deren Oberhaupt Frank Wood, genannt der 'Bucklige' ist." So beginnt die österreichische Abenteuerfilmserie "Die Huronen", die 1922 als "Die Vampire von New York" in die deutschen Kinos kommt. Von den vier Teilen "Die Geheimdokumente", "Die Marderhöhle", "Die Katakomben" und "Der Kampf mit dem Buckligen" sind heute noch zahlreiche Episoden erhalten, die alles bieten, was einen Sensationsfilm der Nachkriegszeit auszeichnet: ein genialer Verbrecher, eine geheimnisvolle Formel, Erpressung und Verrat, Verkleidungen und Geheimfächer, Falltüren und Todeskammern (Foto), Verfolgungsjagden in Auto und Flugzeug. Im Vorprogramm liefert sich in Der schwarze Jack. Das Rätsel der Kriminalistik. Ein Lustspieltrickfilm (D ca. 1922) der Detektiv Fifikus mit dem als "Schwarzer Jack" berüchtigten Einbrecher eine atemberaubende Verfolgungsjagd mit Flugzeug und Eisenbahn – ein früher Animationsfilm, der gekonnt mit den Stereotypen des Detektiv- und Sensationsfilms spielt.

-
‣5. Februar 2009, Zeughauskino, 20.00 Uhr: DAS WUNDER DES SCHNEESCHUHS (D 1920-22)
-
‣26. Januar 2009, FilmDokument, Arsenal, 18.30 Uhr: Konzeption und Moderation eines Programms mit Kurzfilmen zur Verfolgung von und dem Mord an Juden durch Deutsche und zur Befreiung der Konzentrationslager (Programm zum Internationalen Holocaust-Gedenktag 2009)
-
‣8. Januar 2009, Zeughauskino, 20.00 Uhr: KAMPF UM DEN HIMALAYA (D 1938)
-
‣22. November 2008, Zeughauskino, 19.30 Uhr: AMERICA GOES OVER (USA 1925)
-
‣4. November 2008, Zeughauskino, 20.00 Uhr: THE BATTLE OF THE SOMME (GB 1916)
-
‣31. Oktober 2008, Deutsche Kinemathek, Symposium "Der Erste Weltkrieg im Film". Vortrag: Von der Somme zur Somme. Strategien des "nicht-dokumentarischen" Films der 1910er und 1920er Jahre.
-
‣24. Oktober 2008, Arsenal 2, 20.30 Uhr, FilmDokument: Wiederentdeckte Avantgardefilme der 20er Jahre
-
‣26. September 2008, Görlitz, Apollo, 19.00 Uhr (Trickfilmtage 26.-28.9.2008): Vortrag und Filmprogramm "Avantgarde und Modernität im deutschen Animationsfilm bis 1945"
-
‣25. September 2008, 20.00 Uhr, Zeughauskino, Kunst des Dokuments – Bauen und Wohnen (u.a. ABBRUCH UND AUFBAU, D 1932, R: Wilfried Basse)
-
‣18. September 2008, 20.00 Uhr, Zeughauskino, Kunst des Dokuments – Bauen und Wohnen (u.a. DIE STADT VON MORGEN, D 1930)
-
‣30. August 2008, 20.30 Uhr, Zeughauskino: ANDREAS SCHLÜTER (D 1942, R: Herbert Maisch)
-
‣26. Juli 2008, 19.00 Uhr, Zeughauskino: HOTEL ADLON (BRD 1955, R: Josef von Baky),
-
‣21. Juni 2008, 21.00 Uhr, Zeughauskino: DIE 3-GROSCHEN-OPER (D 1931, R: G. W. Pabst) (Reihe: Verstummte Stimmen)
-
‣20. Juni 2008, 18.30 Uhr, Zeughauskino: DAS LAND DES LÄCHELNS (D 1930, Max Reichmann) (Reihe: Verstummte Stimmen)
-
‣30. Mai 2008, 19.30 Uhr, Arsenal 2, Reihe FilmDokument: ALOIS GUGUTZER ODER DAS ZELLULOID LÄSST EINEN NICHT LOS (BRD 1979, R: Peter Goedel) Film im Film (4)
-
‣25. Mai 2008, 20.00 Uhr, Zeughauskino: DIE UNBESIEGBAREN (DDR 1953, R: Arthur Pohl)
-
‣17. Mai 2008, 19.00 Uhr, Zeughauskino. DIE LIEBE UND DIE ERSTE EISENBAHN (1934, Regie: Hasso Preis)
-
‣10. Mai 2008, 18.30 Uhr, Arsenal 2, FilmDokument: Zur Erinnerung an den Aprilboykott und die Bücherverbrennung vor 75 Jahren
-
‣27. April 2008, 21.00 Uhr, Zeughauskino, Wiederentdeckt, Nr. 132: Hommage an Margo Lion. 24 STUNDEN AUS DEM LEBEN EINER FRAU (1931, Regie: Robert Land) – W 130-132 Hommage an Margo Lion.pdf – Die überschlanke Gestalt, die ungewöhnliche Altstimme und eine exzentrische Gestik sind ihre unverwechselbaren Merkmale. Im Berlin der 20er Jahre ist die 1900 in Konstantinopel von französischen Eltern geborene Margo Lion als Chansonnière und Schauspielerin ein Star der Kabarett- und Revueszene. 1933 emigriert sie nach Frankreich, wo sie eine zweite Karriere als Brecht-Interpretin einschlägt und in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen mitwirkt. Im Rahmen der Berliner Festwochen tritt sie 1977 noch einmal mit ihren Chansons in Berlin auf. Margo Lion stirbt 1989 in Paris. – Zwischen 1926 und 1932 ist Margo Lion auch in zehn Spielfilmen zu sehen. Es sind nur kurze Szenen, in denen sie als komisch-verrückte Type oder als Sängerin in Erscheinung tritt. Doch jeder Auftritt wird zum Ereignis. Unvergessen ihre Jenny in der französischen Fassung der 3-Groschen-Oper (1931) von G.W. Pabst. – Drama nach der gleichnamigen Novelle von Stefan Zweig. Helga Vanroh hat sich nach dem Tod ihres Gatten ganz in sich zurückgezogen und verzehrt sich in ihrer Einsamkeit. Eines Tages wird sie im Kasino auf einen jungen Mann aufmerksam, der wie besessen und voller Verzweiflung seine Einsätze tätigt – und verliert. Da sie befürchtet, er könne sich etwas antun, folgt sie ihm des Nachts in sein schäbiges Hotel. Er verspricht ihr hoch und heilig, mit dem Spielen aufzuhören. Daraufhin gibt sie ihm Geld, damit er abreisen kann. Aber am anderen Tag trifft sie ihn wieder im Spielsaal an... – Die Fachpresse bewertet den Film durchgehend kritisch; der Film etwa bezeichnet ihn als "fades Gespensterspiel." Vor allem das Spiel der Hauptdarstellerin wird kritisiert: "Henny Porten, eindeutige Verkörperin alles Seelisch-Geraden, soll hier 24 Stunden Nervensensationen spielen. Gefühls-Triebe, das Tiefunten, das dornendichte Gestrüpp des Herzens’. Unmöglich. Sie kann den Frieden ihrer Augen nicht verleugnen." (Film-Kurier). Heute überrascht die kluge Ausnutzung der Tonfilmmöglichkeiten, insbesondere in den ausgedehnten Szenen im Spielcasino – und natürlich "Margo Lion, die jeden Film belebt" (Film-Kurier). "Eine reine Freude Margo Lion, die wieder einmal fahrig-mondän-klatschsüchtig eine Type par excellence auf die Beine stellte." (LichtBildBühne)
-
‣26. April 2008, 21.00 Uhr, Zeughauskino, Wiederentdeckt, Nr. 131: Hommage an Margo Lion. DIE GROSSE ATTRAKTION (1931, Regie: Max Reichmann) – W 130-132 Hommage an Margo Lion.pdf – Sängerfilm mit Richard Tauber. "Um es vorwegzunehmen: der gesanglich und tonlich reizvollste Tauberfilm, den man bis jetzt kennt. Tauber ist strahlender, hinreißender denn je..." (LichtBildBühne). Der Sänger Riccardo ist Leiter einer vierzigköpfigen erfolgreichen Varieté-Truppe. Das quirlige Tanz-Girl Kitty aus einer anderen Gruppe verliebt sich in ihn und drängt sich mit einem frechen Trick in seine Truppe. Aber Riccardo hängt immer noch seiner ehemaligen Frau nach – bis er sie wieder trifft und feststellt, dass sie sich fremd geworden sind und er tatsächlich nur Kitty liebt... – Die große Attraktion entsteht zum Teil auf der großen Bühne des Berliner Varieté Wintergarten und enthält zahlreiche artistische Glanznummern. Wie ein roter Faden ziehen sich die komischen Auftritte des stets zerstrittenen Artistenpaares Juane (Margo Lion) und Selite (Siegfried Arno) durch die Handlung: "Margo Lion ist hervorragend in ihrer mondänen Hysterie, Siegfried Arno zurückhaltender als sonst, verinnerlichter und dennoch eindringlicher." (Der Film) "Ausgezeichneter, bei einem besseren Publikum entscheidender Erfolgsfaktor Margo Lion. Ihre verrückt-nervöse Juane ist eine Figur, die den Rahmen des Films sprengt. (...) Herrlich ein paar kurze Szenen zwischen Arno und der Lion!" (LichtBildBühne)
-
‣26. April 2008, 19.00 Uhr, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 130: Hommage an Margo Lion. Die Koffer des Herrn O.F. (D 1931, R: Alexis Granowsky) – W 130-132 Hommage an Margo Lion.pdf – Groteske. In dem kleinen Hotel des verschlafenen Provinznestes Ostend werden eines Tages 13 große Reisekoffer – nur mit O.F. etikettiert – abgeliefert. In Erwartung des unbekannten, aber offenbar unermesslich reichen Gastes bricht in dem Ort ein regelrechter Bauboom aus. Ein rasanter Wirtschaftsaufschwung setzt ein, über dessen Ursachen die Gelehrten der Weltwirtschaftskonferenz jahrelang ergebnislos konferieren... – Eine burleske Zeitsatire, ein modernes Märchen und ein typischer Film aus dem experimentellen Geist der Zwanziger Jahre, von dem Exilrussen Alexis Granowsky exzentrisch in Szene gesetzt und von Raimar Kuntze sachlich und scharf konturiert fotografiert. Karol Rathaus komponiert schräg und skurril nach Texten von Erich Kästner; die Lewis-Ruth-Band spielt auf und Ernst Busch singt. Peter Lorre ist ein verschmitzter Lokalredakteur, Hedy Kiesler jung und schön und Margo Lion ein Kabarettstar, der die Verruchtheit des Berliner Nachtlebens in das beschauliche Ostend bringt: "Als besonderen Effekt gibt es ein Chanson der Margo Lion. Und das ist herrlich. Nonchalant legt sie es hin, und doch sehr bedacht darauf, wie es wirkt. Pointen, geschüttelt aus einem Handgelenk, das trainiert ist." (Hans Feld, Film-Kurier, 1931)
-
‣25. April 2008, Arsenal 2, FilmDokument 102: Werkberichte. Wie die fünfziger Jahre die Arbeit am Film darstellen... Film im Film (3)
-
‣20. April 2008, Zeughauskino, Reihe Jeanne d'Arc: DAS MÄDCHEN JOHANNA (1935, Regie: Gustav Ucicky)
-
‣28. März 2008, Arsenal 2, FilmDokument 101: Im Wunderreich des Tonfilms. Wie die Kamera auf Jagd geht und der Film auf seine Geschichte zurückblickt... Film im Film (2)
-
‣21. März 2008, Zeughauskino, Reihe: Helmut Käutner: Schwarzer Kies (BRD 1961, R: Helmut Käutner) – Handout – Ein Dorf im Hunsrück, 1960. Auf einem Flugplatz der Amerikaner wird eine neue Piste für Raketenrampen gebaut. Bei dem Versuch, eine LKW-Ladung Kies zu stehlen, wird ein Liebespaar überfahren; die Leichen verschwinden unter dem Kies der Landebahn... – Der Film entsteht in Lautzenhausen, einem 500-Seelen-Ort im Hunsrück, der sich durch die nahe Militärbasis in eine Art Goldgräberstadt verwandelt. Scheunen und Gasthäuser werden zu Bars und Vergnügungsstätten für die GIs umgebaut. In dieser Atmosphäre aus Geldgier, Korruption und Vergnügungssucht kommt man leicht auf die schiefe Bahn. Käutner inszeniert wirklichkeitsnah, die Mädchen in der Atlantic-Bar spielen sich ebenso selbst wie viele der mitwirkenden amerikanischen Soldaten. Zusätzliche Aufnahmen entstehen auf den Schotterwegen am Berliner Teufelsberg. Käutners Versuch, einen spannungsgeladenen, reißerischen film noir kritisch-realistisch zu unterfüttern, stößt jedoch weitgehend auf Ablehnung: Eine "völlig missglückte Zeitkritik", urteilt Karena Niehoff im Tagesspiegel (18.5.1961). Die Jury "Junge Filmkritik" verleiht ihm gar einen Preis für "die schlechteste Leistung eines bekannten Regisseurs." Opas Kino war tot – dass es aber so schlecht nicht war, belegt dieser Film.
-
‣14. März 2008, Frankfurt am Main, Arbeitsgruppe Cinematographie des Holocaust. Was ist Antisemitismus im Kino? Filmeinführung zu BETTERSON & BENDEL (SWE 1933; Dt. Fassung: 1938)
-
‣29. Februar 2008, Arsenal 2: FilmDokument 100: Ein Blick hinter die Kulissen. Wie Stummfilme produziert werden und wie sie brennen... Film im Film (1)
-
‣25. Januar 2008, Arsenal 2: FilmDokument 99: WIDERSTAND. VOM KAMPF GEGEN HITLER IN DEUTSCHLAND 1933-1945 (BRD 1961, R: Otto Erich Kress, Hans Dieter Schiller)
-
‣16. Dezember 2007, Zeughauskino: SCHICKSALSWENDE (D 1939) und CRISIS (USA/CSR 1939), Reihe: "Film im Herzen Europas"
-
‣9. November 2007, Arsenal 2: FilmDokument 97: Rotorange und blaugrün – Kultur- und Werbefilme in Ufacolor (1931-38). Bunte Filmschätze (5)
-
‣19. Oktober 2007, Arsenal 2: FilmDokument 96: Tradition und Moderne – Die Weimarer Republik in Farbe – Bunte Filmschätze (4)
-
‣28. September 2007, Arsenal 2: FilmDokument 95: Kriegsschau und Prothesenkunst. Der Erste Weltkrieg in Farbe. – Bunte Filmschätze (3)
-
‣20. September 2007, Zeughauskino, Reihe: Kunst des Dokuments. "Das Wunder der Natur vollendet sich..." Tiere sehen dich an! Tierfilme von 1921-1936
-
‣13. Juli 2007, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 113: Großstadtschmetterling. Ballade einer Liebe (D/GB 1929, Richard Eichberg) – W 113 Großstadtschmetterling.pdf – Hatte sich der grazile Reiz der Anna May Wong in "Song" (1928) noch im Rahmen des rauen Seefahrer- und fernöstlichen Kneipenlebens zu entfalten, so bringt Eichberg ihn in "Großstadtschmetterling" im vergleichsweise verfeinerten gesellschaftlichen Milieu der Pariser Bohème zur Geltung. Aber selbst hier hat es Anna May Wong, diesmal in der Rolle der schönen chinesischen Tänzerin Mah, mit einem mehr als nur latent gewalttätigen Widerpart zu tun: dem brutalen Coco, gespielt von Alexander Granach, dessen unbändiges Verlangen ihn auch vor Mord und Diebstahl nicht zurückschrecken lässt. Auf der Flucht vor Coco verdingt sich Mah als Modell bei dem russischen Maler Kusmin (Fred Louis Lerch), in den sie sich alsbald verliebt. Als dieser ihr einen Scheck zur Einlösung bei der Bank anvertraut, lauert Coco ihr auf. Mah muss Coco das eingewechselte Geld aushändigen, lässt sich aber nicht zwingen, mit ihm zu gehen. Das Mädchen gerät selbst in Verdacht, den Maler hintergangen zu haben, da sie die Drohung Cocos ernst nimmt, Kusmin zu töten, wenn sie ihm die Wahrheit sagt. Verzweifelt sucht sie nach einem Weg, ihre Unschuld zu beweisen. Wie die zeitgenössische Kritik befand, ist Anna May Wong "auch hier […] noch von sublimen, durchdringenden, erhellenden Ausdruckskräften und Reizen. Wenn sie schleicht, wenn sie flüchtet, wenn sie tanzt, wenn sie spielt, wenn sie blickt." (Berliner Tageblatt, Nr. 176, 14.4.1929).
-
‣29. Juni 2007, Arsenal 2: FilmDokument 94: Aktualitäten und Stimmungsbilder vor 1914 – Bunte Filmschätze (2)
-
‣8. Juni 2007, Zeughauskino: Shoah im Widerstreit. Les camps de la mort (F 1945), Die Todesmühlen (USA 1945), Todeslager Sachsenhausen (SBZ 1946)
-
‣25. Mai 2007, Arsenal 2: FilmDokument 93. Granatzünder, Lokomobile und Metallgeld – Bunte Filmschätze (1): Frühe farbige Industriefilme
-
‣27. April 2007, Arsenal 2: FilmDokument 92. Flugzeugwerke und Luftkämpfe im Ersten Weltkrieg – Industrie- und Propagandafilme von 1917/18: Die Pfalz-Flugzeugwerke (1918) Die Entdeckung Deutschlands (1917) Luftkämpfe (1917) Rentier Kulickes Flug zur Front (1918)
-
‣4. März 2007, Kino Gesellschaft Köln: ACCIAIO (IT 1933, R: Walter Ruttmann) + Kurzfilme (1935-40) von Walter Ruttmann
-
‣3. März 2007, Zeughauskino, "Film und Propaganda". TRIUMPH DES WILLENS (1935, R: Leni Riefenstahl)
-
‣2. März 2007, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 103. Ich hatt' einen Kameraden (D 1926, R: Conrad Wiene, D: Grete Reinwald, Frida Richard, Olaf Fjord, Carl de Vogt, Hans Albers, ca. 76') – Handout – "Ein Drama aus den Heldentagen der deutschen Kolonien" – mit diesem Werbespruch startete der unter Förderung der ehemaligen Gouverneure der deutschen Schutzgebiete herstellte Film "Ich hatt' einen Kameraden". Er wurde am 30. Juli 1926 anlässlich der in Hamburg abgehaltenen "Kolonialen Werbewoche" uraufgeführt. "Wirklichkeitsgetreue Bilder voll heldenhaften vaterländischen Erlebens aus schwerer Zeit" bewunderte die konservative Tägliche Rundschau. Die überlieferte Fassung des Films ist um ein Drittel gekürzt und reduziert ihn weitgehend auf seine melodramatischen und abenteuerlichen Handlungselemente. Aber auch in diesem Fragment kommt die propagandistische Botschaft dieses "vaterländischen Kolonialfilms" noch unverblümt zum Tragen. – Im Vorprogramm zeigen wir einen Dokumentarfilm über eine Besichtigungstour, die Wilhelm Solf, Staatssekretär im Reichskolonialamt, der deutschen Kolonie Togo im Jahre 1913 abstattete: Staatssekretär Dr. Solf in den Kolonien (D 1914, ca. 12’)
-
‣2. Februar 2007, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 102. Der galante König. Ein Kulturbild aus dem Barock (D 1920, R: Alfred Halm, D: Rudolf Basil, Ria Jende, Eva Speyer, Dora Kasan, ca. 100', viragiert, niederländische Zwischentitel) – W 102 Der galante König.pdf – Ein Prunkfilm über die Liebesabenteuer August des Starken (1699-1763), sächsischer Kurfürst und König von Polen, gedreht an Originalschauplätzen in den Straßen Alt-Dresdens und den Schlössern von Pillnitz und Moritzburg. "Ein Prachtschaustück ersten Ranges. Glänzende Aufzüge, Hoffeste mit dem Aufwand der damaligen Verschwendung und Üppigkeit, phantasievolle Schauspiele, den bizarren Launen dieses prachtliebenden Fürsten entsprungen, wechseln in mustergültiger Weise mit Kriegszügen, jubelnden Volksmassen und Schlachtgetümmel." (Der Film) Der sozialdemokratische Vorwärts kritisierte dagegen den "pathetischen Prunk" dieses Historienbildes als "hohl, nichtig, äußerlich arrangiert." Mitarbeiter des Sächsischen Staatstheaters hatten die Dekorationen entworfen, auch ein Militärhistoriker stand dem Regisseur zur Seite. Aufgewertet wurde der Monumentalfilm noch durch eine nach historischen Originalkompositionen zusammengestellte Kinomusik. Die schön viragierte niederländische Verleihfassung ist auch ohne niederländische Sprachkenntnisse verständlich.
-
‣26. Januar 2007, Arsenal 2: FilmDokument 88. Neue Welt – Vom Wigwam zum Wolkenkratzer (BRD 1954, Kurt Oertel)
-
‣29. November 2006, Zeughauskino. "DIE PAMIR." EIN DOKUMENTARFILM ÜBER DIE LETZTEN GROSSEN SEGLER (BRD 1959)
-
‣31. Oktober 2006, Leipzig: Dokfestival. Eröffnung der Retrospektive "Lichtspiele – Klassische Avantgarde und Experimentalfilme in Deutschland"
-
‣1. September 2006, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 97. Wien, Du Stadt der Lieder (D 1930 R: Richard Oswald) – W 97 Wien, Du Stadt der Lieder.pdf – Unverhohlen buhlt dieser Film um den Beifall des breiten Publikums. 55 Filmkopien waren Mitte 1930 im Einsatz, um die große Nachfrage zu befriedigen. Richard Oswald verzichtet darauf, einen weiblichen Star in Szene zu setzen, wie der zeitgleich herausgekommene "Blaue Engel" der Ufa. Mit Siegfried Arno, Max Ehrlich, Paul Graetz, Max Hansen, Sigi Hofer und Paul Morgan setzt er vielmehr auf die Größen des berühmten Berliner "Kabaretts der Komiker". Unterstützt werden sie von dem Schallplattenstar Luigi Bernauer als Heurigensänger. "Sie kamen, sprachen, sangen und siegten" – so ein Kritiker. Die Filmhandlung dreht sich um Liebe und Losglück. Sie ist Vorwand für eine turbulente Szenenfolge voll derb-komischen Humors; keine noch so plumpe Pointe wird ausgelassen. Die schrulligen, aber liebenswerten Kleinbürger öffnen nur beim Heurigen ihr Herz: "Wien, Du Stadt der Lieder / Blüht im Lenz der Flieder / Zieht mein Herz mich immer wieder zu dir hin / du mein Wien, mein liebes Wien." Gegen die Wiener Gemütlichkeit setzt Paul Graetz eine schnoddrige Liebeserklärung an Berlin. – Ein früher Tonfilm, der durch sein ungeniertes Schielen auf jeden Lacher mit dazu beitrug, dass auch das Massenpublikum den Tonfilm als neues Medium akzeptierte. Im Vorprogramm der Kombinations(trick)film Lustige Hygiene, Nr. 7 (D 1930, Produktion: Excentric-Film Zorn & Tiller GmbH, Berlin).
-
‣5. April 2006, Kunstmuseum Stuttgart. Optische Musik – Viking Eggelings absoluter Film SYMPHONIE DIAGONALE (1925)
-
‣24. Februar 2006, Arsenal 2: FilmDokument 81. Kunst und Künstler im Film der 20er Jahre
-
‣12.-14. Januar 2006, Frankfurt am Main, Nuremberg and its Lesson, Teil 2. Jahrestagung der Arbeitsgruppe "Cinematographie des Holocaust". "Wir beabsichtigen nicht, das ganze deutsche Volk zu beschuldigen." Die Wochenschau WELT IM FILM über den Nürnberger Prozess. Vortrag mit Filmbeispielen
-
‣16. Dezember 2005, Arsenal 2: FilmDokument 79. DIE REICHSBAHN UNTERFÄHRT BERLIN (1935) ... und andere Filme der Reichsbahn-Filmstelle über den Bau der Nordsüd-S-Bahn in Berlin
-
‣2. Dezember 2005, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 88. Grock (D 1931, R: Carl Boese) – W 88 Grock.pdf – "Grock, der Clown, der sich von der Bühne zurückgezogen hat, gibt seine Abschiedsvorstellung. Die ganze Welt ist Parkett, solange das Negativ dieses Tonfilms existiert und Tonkopien durch die Apparate rasseln. Grock hat sich selbst ein Denkmal gesetzt. Nach Jahren werden die Menschen, die diesen Film sehen, noch sagen: Dieser Grock war ein großer Clown, ein begnadeter Künstler, ein Genie in seinem Beruf. Dieser Film wird eindringlicher von Grocks Ruhm erzählen als jede gedruckte Schilderung." So der Film-Kurier 1931 in seiner Uraufführungs-Kritik. – Carl Boese hat diesen "Tonfilm aus dem Leben eines weltberühmten Artisten" inszeniert. Im Mittelpunkt steht der weltberühmte Schweizer Clown Grock (Adrien Wettach, 1880-1954). Der erste Teil des Films bringt eine belanglose Handlung um und mit Grock, der sich nach seiner Abschiedsgala nur noch für die Gartenarbeit interessiert und damit seine mondäne Frau (Liane Haid) zutiefst langweilt. Es kommt zum Zerwürfnis, zur Trennung – und zum zweiten Teil des Films, der die erfolgreichsten Auftritte und klassischen Nummern Grocks als Tonfilmreportage festhält. "Er singt und tanzt und jongliert und schneidet Grimassen – es ist herrlich!" (Film-Kurier) Diese dokumentarische Inszenierung, ergänzt durch einige nur im Tonfilm möglichen Tricks, ist der eigentliche Gewinn dieses Films. "Denn dieser große Varietéakt veraltet nie, wird noch nach hundert Jahren sicher wieder erfreuen, und das allein schon macht diese Film liebens- und lobenswert." (Der Kinematograph) Der in fünf Sprachversionen gedrehte Film war lange Zeit nur in der französischen Fassung bekannt. Wir zeigen erstmalig die deutsche Originalversion
-
‣23. November 2005, Filmmuseums Potsdam. Ernstfall Demokratie. Fundstücke für eine politische Kultur in Deutschland, Programm IV: Deutsche Erfahrungswelten. 1) Re-education-Filme, 2) BEGEGNUNG AN DER ELBE (UdSSR 1949, R: Grigorij Alexandrow)
-
‣21. Oktober 2005, Arsenal 2: FilmDokument 77. DIE KAMERA FÄHRT MIT (1936) und Wochenschauberichte zur Olympiade 1936 in Berlin
-
‣7. Oktober 2005, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 86. Die Blitz-Zentrale (D 1921 R: Valy Arnheim) – W 86 Die Blitz-Zentrale.pdf – Der dritte Großfilm der Harry Hill-Sensations-Detektiv-Serie dreht sich um das geheimnisvolle Metall Platinaphor. Diese Erfindung ermöglicht es, die Energie des Blitzes einzufangen und dem Wohle der Menschheit nutzbar zu machen. Mit allen Mitteln versucht ein ausländischer Konzern, in den Besitz der Formel zu gelangen. "Die Blitz-Zentrale" enthält alle Zutaten eines spannendes Detektiv-Films: ein Motorbootrennen, ein geheimnisvolles Versteck, eine Flucht über die Dächer der Großstadt, ein vergifteter Regenschirm, ein Fallschirmabsprung von einem Hochhaus, wechselnde Verkleidungen und Masken, Verfolgungsjagden, ein explodierender Dampfer, als Filmteam getarnte Ermittler und mehrere Rettungen in letzter Minute. Das Tempo der modernen Welt feiert Triumphe. Als zusätzlicher Schauwert ausgelegt ist der Kampf des eleganten Detektivs Harry Hill (Valy Arnheim) mit seiner ebenso schönen wie skrupellosen Gegenspielerin Giona da Conre (Marga Lindt). - Die überlieferte Kopie enthält zahlreiche rot, grün und orange viragierte Szenen.
-
‣30. September 2005, Arsenal 2: FilmDokument 76. Werbefilme zur Olympiade 1936 in Berlin
-
‣3. September 2005, Technischen Museum Wien: Filmworkshop über die Marshall-Plan Filme im Zusammenhang mit der Ausstellung "Österreich baut auf. Wieder-Aufbau und Marshall-Plan". Ich und Mr. Marshall – ERP-Filme in Deutschland 1948 bis 1952
-
‣27. Mai 2005, Arsenal 2: FilmDokument 74. FUSSBALLWELTMEISTERSCHAFT 1954 (BRD 1954)
-
‣16. Februar 2005, Deutsches Historisches Museum, Berlinale 2005: Selling Democracy – Winning the Peace. Workshop und Vortrag: Demokratie lernen? Mut zur Demokratie. Amerikanische und britische Re-orientation-Filme 1948-52
-
‣28. Januar 2005, Arsenal 2: FilmDokument 71. Französische Dokumentarfilme zum Holocaust (zusammen mit Jörg Frieß)
-
‣17. Dezember 2004, Arsenal 2: FilmDokument 70. Rhythmus, Studien, Zauber. Hans Richter Avantgarde Filme 1925-1933
-
‣9.-10. Dezember 2004, Bibliothek des Ruhrgebiets, Bochum. Filme, die arbeiten. Internationale Tagung zum Industriefilm. Der Industriefilm in seiner Geschichte: eine Präsentation älterer und aktueller Beispiele / On the History of the Industrial Film: A Short Film Program
-
‣5. November 2004, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 76. Gretel zieht das große Los (D 1933, R: Carl Boese) – W 76 Gretel zieht das große Los.pdf – Die Verkäuferin in einem Klaviergeschäft (Lucie Englisch) gewinnt, nach einer liebenswürdigen Notlüge über einen Lotteriehauptgewinn, schließlich doch das große Los: das Herz eines Barpianisten (Hans Brausewetter). Ehe sich aber beide in die Arme fallen, durchlebt die unbedarfte Schwindlerin noch zahlreiche, durch ihre Mogelei ausgelösten Verwicklungen. – Zu Weihnachten 1933 uraufgeführt, zeigt sich in dem von Routinier Carl Boese inszenierten Lustspiel bereits der Einfluss des neuen Regimes. In der Berliner Canari-Bar geht es so sittsam zu wie in einer Tanzstunde. Nur die geschiedene Frau des Pianisten (Hilde Hildebrand), ein Zerrbild der emanzipierten Frau der Zwanziger Jahre, schlägt über die Stränge und wirft betrunken mit Champagnergläsern um sich. Dagegen strahlt die Verkäuferin, die so gerne Angestellte bleiben möchte und deren größter Traum ein Radio ist, nicht nur Bescheidenheit und Häuslichkeit, sondern auch Provinzialität aus – die Fallhöhe reicht aus, um ein vergnügliches Lustspiel entstehen zu lassen.
-
‣30. Oktober 2004, Arsenal 2: FilmDokument 68. DIE WELT UM DEN GÖTTERBERG (1928). Fünf Kulturfilme von Paul Lieberenz der 20er und 30er Jahre über Kamerun.
-
‣17. September 2004, Arsenal 2: FilmDokument 67. Scherenschnittfilme der 20er Jahre
-
‣4. August 2004, Deutsches Historisches Museum, im Rahmen der Ausstellung „Strategien der Werbekunst 1850-1933“. Vortrag über den künstlerischen Werbefilm der 20er Jahre
-
‣4. Juni 2004, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 73. Der Herr Bürovorsteher (D 1931, R: Hans Behrendt) – W 73 Der Herr Bürovorsteher.pdf – Ein Lustspiel, das Felix Bressart alle Möglichkeiten bietet, seinen sperrig-schlacksigen Körper zu verrenken und mit artistischen Sprachverdrehungen zu glänzen. Als überkorrekter Bürovorsteher Reißnagel einer Anwaltskanzlei verwaltet er das ominöse "Konto X" seines lebenslustigen Chefs, als Vorsteher und Dirigent des Radfahrervereins "Deutsche Speiche" inszeniert er kleinbürgerliche Gemütlichkeit. Walter Kollo komponierte nicht nur deren Hymne "Immer die Radfahrer", sondern auch einen Tango und das Schlusslied "In meiner kleinen Laube steht 'ne Bank, mein Schatz".
-
‣April 2004, Festivalkino Metropolis: 16. Filmfest Dresden. German 40s. Farbige Unterhaltung in dunklen Zeiten. Deutsche Zeichenfilme 1940-1944
-
‣21. November 2003, Arsenal 2: FilmDokument 59. AMERIKA, DAS LAND DER UNBEGRENZTEN MÖGLICHKEITEN (1926)
-
‣31. Oktober 2003, Arsenal 2: FilmDokument 58. DAS BLUMENWUNDER (1926)
-
‣28. März 2003, Arsenal 2: FilmDokument 53. PARADIES UND FEUEROFEN (BRD 1958, R: Herbert Viktor)
-
‣28. Februar 2003. Arsenal 2: FilmDokument 52. IM AUTO DURCH ZWEI WELTEN (1931, R: Clärenore Stinnes) + BEI DEN DEUTSCHEN KOLONISTEN IN SÜDWEST-AFRIKA. BILDER VON ELLY BEINHORN’S AFRIKAFLUG 1933 (1934, R: Elly Beinhorn)
-
‣31. Januar 2003. Arsenal 2: FilmDokument 51. DIE SENDUNG DES TONFILMS (D 1929) und andere Kurztonfilme von 1929
-
‣24. September 2002, Arsenal 2: FilmDokument 47. Vor 75 Jahren – Uraufführung von BERLIN. DIE SINFONIE DER GROßSTADT (1927, R: Walter Ruttmann)
-
‣27. Juni 2002, Arsenal 2: FilmDokument 46. Traumspiele. Künstlerische Animationsfilme der BRD: die 50er Jahre
-
‣14. Juni 2002, Filmmuseum Potsdam, Veranstaltung der Musikfestspiele Potsdam und dem Filmmuseum. Musik zu bewegten Bildern – Filmische Avantgarde. An der Welte-Kino-Orgel: Helmut Schulte
-
‣31. Mai 2002, Arsenal 2: FilmDokument 45. HERRLICHE ZEITEN (BRD 1950, R: Erik Ode)
-
‣22. Februar 2002, Arsenal 2: FilmDokument 42. Berlin zur Kaiserzeit. Frühe Filme aus der Reichshauptstadt
-
‣25. Januar 2002, Arsenal 2: FilmDokument 41. (DIE TODESMÜHLEN, USA 1945, R: Hanus Burger) + WELT IM FILM Nr. 6/1945 + Nr. 82/1946
-
‣26. Oktober 2001, Arsenal 2: Filmdokument 39. 10 Jahre CineGraph Babelsberg. 16mm- und Super8-Kurzfassungen deutscher Filmklassiker (zusammen mit Ralf Forster) – FD 39 16mm- und Super8-Kurzfassungen deutscher Filmklassiker.pdf – Seit den Anfängen der Kinematographie konnten Film-Amateure immer auch Filme für den Heimbedarf kaufen: zerschnittene Kinofilme, abgespielte Wochenschauen, aber auch Kurzfassungen gängiger Filme – ein noch unerforschtes Kapitel Filmgeschichte. Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens präsentiert CineGraph Babelsberg, Berlin-Brandenburgisches Centrum für Filmforschung e.V., ein Programm mit Kurzfassungen großer Filme auf 16mm und Super8.
-
‣27. April 2001, Arsenal 2: Filmdokument 35. Berlin – Freiburg – Trier. Kurzfilme des Kaiserreichs (zusammen mit Uli Jung und Martin Loiperdinger)
-
‣23. Februar 2001 (Wiederholungen: 1. und 2. April 2001), Arsenal 2: Filmdokument 33. DIE STADT DER MILLIONEN. EIN LEBENSBILD BERLINS (1925, R: Adolf Trotz)
-
‣26. Januar 2001, Arsenal 2: Filmdokument 32. IM SCHATTEN DER WELTSTADT (1930) und andere Tatsachenfilme von Albrecht Viktor Blum (1928-1930)
-
‣24. November 2000, Arsenal 2: FilmDokument 30. Amerikanische Re-education-Filme 1949-1953
-
‣3.-4. Februar 2000. Siegen, Tagung des DFG-Projekts "Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland 1895-1945". Vortrag zur deutschen Ton-Wochenschau
-
‣10. Januar 2000, Arsenal: FilmDokument 27. GIGANT BERLIN. DIE ERREGENDSTE STADT DER WELT (BRD 1964, R: Leo de Laforgue)
-
‣14. September 1999, Arsenal: FilmDokument 23. Aspekte des Lehrfilms. Wilfried Basse zum 100. Geburtstag
-
‣26. und 27. Juni 1999, Arsenal: FilmDokument 21. Märchenhafte Silhouettenfilme. Zum 100. Geburtstag von Lotte Reiniger (2.6.1899 - 19.6.1981) – FD 21 Märchenhafte Silhouettenfilme Handout.pdf – Lotte Reiniger glaubte mehr an Märchen als an Zeitungen, sie war ballett-, film- und theaterbesessen und hatte einen ausgeprägten Mozart-Fimmel. Die vor hundert Jahren in Berlin geborene Künstlerin begründete in den 20er Jahren das Genre des Silhouettenfilms. Mit einer nie erlahmenden Spielfreude schuf sie bis in die 70er Jahre insgesamt an die 80 Silhouettenfilme. Ihr gelang eine einzigartige Verbindung des besonders im Biedermeier gepflegten Scherenschnitts und des javanesischen Schattentheaters, eine Synthese aus romantischem Empfinden und überbordender Fabulierfreude. So entstanden selten leichte und elegante, filigran gestaltete Streifen, getragen von einem sanften und weisen Humor. Ihr unbestrittenes Meisterwerk ist der von 1923 bis 1926 entstandene erste abendfüllende Animationsfilm der Filmgeschichte: Die Abenteuer des Prinzen Achmed (D 1926) nach Figuren und Motiven aus den Märchen aus 1001 Nacht. In den durchbrochenen Gewändern und den verschlungenen Ornamenten der orientalischen Szenerie steckt eine fast manische Detailverliebtheit. Auffällig die Gestaltung der guten Hexe als eine Art Urmutter, während der Prinz Achmed sich als zierlicher, fast femininer Held präsentiert. Für Spezialeffekte zog Lotte Reiniger Walter Ruttmann (abstrakte Formenspiele und Zaubereffekte) und Berthold Bartosch (Seesturm) hinzu. Wir zeigen die kürzlich vom Deutschen Filmmuseum, Frankfurt am Main, restaurierte Fassung. Sie geht auf eine viragierte Nitrokopie der Exportversion zurück, die um die deutschen Zwischentitel ergänzt wurde. (26. Juni, 19.00 Uhr, Am Klavier: Willy Sommerfeld). – In ihren Tonfilmen suchte Lotte Reiniger immer wieder die Animation der Silhouetten auf Rhythmus und Takt der Musik abzustimmen. Am 27. Juni 1999 (19.00 Uhr) zeigen wir Kurzfilme, die zwischen 1933 und 1936 entstanden: Carmen (D 1933), Das gestohlene Herz (D 1934), Der kleine Schornsteinfeger (D 1935) zu Kompositionen der Barockzeit, Galathea. Das lebende Marmorbild (D 1935), eine Filmfantasie nach der griechischen Sage vom Bildhauer Pygmalion, sowie Papageno (D 1935) nach Motiven aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“. In dem Dokumentarfilm Ein Scherenschnittfilm entsteht. Lotte Reiniger bei der Arbeit (BRD 1971) demonstriert Lotte Reiniger schließlich Technik und Kunst des heute kaum noch gepflegten Silhouettenfilms. – Lotte Reiniger emigrierte 1936 nach London, wo sie mit Unterbrechungen bis zu ihrem letzten Lebensjahr lebte. Am 2. Juni 1899 in Berlin geboren, stirbt sie am 19. Juni 1981 in Dettenhausen bei Tübingen.
-
‣7. Mai 1999, Arsenal: FilmDokument 20. Schaffende Künstlerhände – Künstlerporträts von Hans Cürlis. Zur Gründung des Instituts für Kulturforschung e.V. vor 80 Jahren am 11. Juni 1919. Beispiele aus dem Filmzyklus Schaffende Hände von Hans Cürlis – FD 20 Hans Cürlis_Handout.pdf – Zur Gründung des Instituts für Kulturforschung e.V. vor 80 Jahren am 11. Juni 1919. Der Kunsthistoriker und Kulturfilmregisseur Hans Cürlis drehte in den 20er Jahren sowie nach dem zweiten Weltkrieg insgesamt 87 kurze Filmporträts von Malern und Bildhauern bei der Arbeit. Er konzentrierte sich dabei vor allem auf die „schaffenden Hände“ - auf das Entstehen des Kunstwerks aus dem Augenblick. Die 20er Jahre: Lovis Corinth zeichnet ein Landschaftsbild, George Grosz arbeitet an einer Federzeichnung, Heinrich Zille läßt eine Berliner Göre und Lesser Ury eine Berliner Straße entstehen, Heinrich Mann steht Max Oppenheimer Modell, Otto Dix zeichnet einen weiblichen Halbakt, Wassily Kandinsky arbeitet in der Galerie Nierendorf abstrakt, während Max Pechstein in seinem Atelier an dem Bild „Fischerboot im Sturm“ malt. Die 50er und 60er Jahre: surrealistische Gesichter von Heinz Trökes, Tierskizzen von Renée Sintenis und Zeichnungen von Alexander Calder. – In einem Porträt von 1975 berichtet zudem Hans Cürlis über seinen Werdegang und seine Verbindung zum Film. Die Filme des Programms: Hans Cürlis, Berlin 1975. Pionier des Kulturfilms und schaffender Künstler (BRD 1975), Lovis Corinth (bearb. BRD 1958/59), George Grosz, Berlin 1923 und 1924 (bearb. BRD 1962), Heinrich Zille auf dem Balkon seiner Wohnung, Berlin 1925 (bearb. BRD 1962), Lesser Ury in seinem Atelier, Berlin 1925 (bearb. BRD 1961), Mopp (Max Oppenheimer), Berlin 1926 und 1928 (bearb. BRD 1991), Otto Dix, Berlin 1926. Zeichnung – Aquarell – Malerei (bearb. BRD 1979), Wassiliy Kandinsky in der Galerie Nierendorf, Berlin 1927 (bearb. BRD 1960/61), Renée Sintenis zeichnet und modelliert ein Fohlen (bearb. BRD 1957), Max Pechstein, Berlin 1927 (bearb. BRD 1961), Alexander Calder, Berlin 1929 und 1967 (bearb. BRD 1978), Heinz Trökes in seinem Atelier, Berlin 1950 (bearb. BRD 1962).
-
‣1999, 11. Filmfest Dresden. Unterhaltung, Werbung und Propaganda. Amerikanische und deutsche Trickfilme von Paul N. Peroff (1886-1980)
-
‣9. April 1999, Arsenal: FilmDokument 19. Ein Märchen aus dunkler Zeit. DIE SIEBEN RABEN (D 1937) und andere Puppentrickfilme der Gebrüder Diehl. – FD 19 Die sieben Raben Handout.pdf – Eine einstündige Puppensaga um sieben verzauberte Brüder, die von ihrer Schwester durch ein sieben Jahre dauerndes Schweigegelübe erlöst werden. Der 1937 fertiggestellte Film folgt dem bekannten Märchen der Brüder Grimm und lehnt sich in seiner Gestaltung an Zeichnungen des Romantikers Moritz von Schwind an. Über ein Jahr arbeiteten die Gebrüder Diehl an diesem ersten abendfüllenden deutschen Puppenanimationsfilm. DIE SIEBEN RABEN mit ihrem märchenhaften Realismus gelten als das Meisterwerk der Gebrüder Diehl. Die mit beweglichen Mundpartien ausgestatteten Puppen wirken lebensecht, die Hintergründe beeindrucken durch Räumlichkeit und Tiefenschärfe. Der Film enthält aber auch beklemmende Szenen eines Inquisitionsprozesses und einer geplanten Hexenverbrennung. – MINIATUR-KABARET (D 1934) ist der erste Tonfilm der Gebrüder Diehl: lustige, leicht parodistische Einfälle bestimmen diese Nummern-Revue, die in einem bayerischen "Watschen-Tanz" ihren Höhepunkt findet.
-
‣5. März 1999, Arsenal: FilmDokument 18. BEWEGTE BILDER. DEUTSCHE TRICKFILME DER ZWANZIGER JAHRE (BRD 1977, R: Rudolf J. Schummer) + FILME IM SCHATTEN. DER TRICKFILM IM DRITTEN REICH (BRD 1977, R: Rudolf J. Schummer) – Handout – Die Geschichte des deutschen Animationsfilms ist noch nicht geschrieben. Zwar gab es immer wieder Ansätze, die aber nicht weiterverfolgt wurden. So stellte 1977 Rudolf J. Schummer zwei heute vergessene Filme über die Höhepunkte des Genres zusammen. Bei BEWEGTE BILDER – DEUTSCHE TRICKFILME DER ZWANZIGER JAHRE half ihm noch die Meisterin des Scherenschnittfilms Lotte Reiniger, die ihre eigenen Filme und die ihrer Zeitgenossen Hans Richter, Viking Eggeling, Walter Ruttmann, Oskar Fischinger und Berthold Bartosch kommentierte. Der zweite Film FILME IM SCHATTEN – DER TRICKFILM IM DRITTEN REICH enthält u.a. Ausschnitte aus Filmen von Rudolf Pfenninger, Hans Fischinger, Hans Fischerkoesen, Wolfgang Kaskeline, Hans Held, den Gebrüdern Diehl, Kurt Stordel und Horst von Moellendorf. Diese selten gezeigten Zusammenstellungen sollen zugleich auf das Genre des Kompilationsfilms aufmerksam machen und an Rudolf J. Schummer erinnern, der 1983 einen Trickfilm-Förder-Verein gründete und mehrere Retrospektiven des deutschen Trickfilms bei internationalen Filmfestivals organisierte.
-
‣4. Dezember 1998, Zeughauskino: Revolution, Berlin 1918/19. Zeitgenössische Wochenschauen und Dokumentarfilme. – In einer einmaligen Zusammenstellung werden die wenigen erhaltenen Originalaufnahmen der Messter-Wochenschau und der Deulig aus den Tagen der Novemberrevolution gezeigt: die Ausrufung der Republik durch Philipp Scheidemann am 9. November 1918, die Straßenkämpfe in Berlin, die Barrikaden im Zeitungsviertel und die Niederwerfung des Spartakus-Aufstands im Januar 1919. In Anna Müller-Lincke kandidiert setzt sich die bekannte Schauspielerin für die Teilnahme der Frauen an den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 ein. Zeichentrickfilme machen Stimmung gegen Spartakus und die junge Republik. in Zusammenarbeit mit CineGraph Babelsberg und der Kinemathek Hamburg. – Revolution, Berlin 1918:19.pdf
-
‣25. Oktober 1998, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 69. Die fidele Herrenpartie (D 1929, R: Rudolf Walther-Fein) – W 69 Die fidele Herrenpartie.pdf – Eine Klamaukiade über eine echt Berliner Himmelfahrts-Herrenpartie. "Ein grunewald-bodenständiger Film, mit Flottheit und Humor gedreht, ein lustigbeschwingtes Drehbuch von Fritz Rauch... Skatclub Eintracht, Restaurant "hier können Familien Kaffee kochen", Flora-Hallen, Havelseen und Freibad – dieses typische Berliner Kleinmilieu ist glänzend getroffen. « (Lucy von Jacoby, 1929)
-
‣25. September 1998, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 68. Einbrecher. Eine musikalische Ehekomödie (D 1930, R: Hanns Schwarz) – W 68 Einbrecher.pdf – Lilian Harvey als kapriziöse Fabrikantengattin, vernachlässigt vom Gatten, will gerade den Avancen eines Lebemannes nachgeben und wird dabei von einem Einbrecher vor "schlimmerem" bewahrt. Der charmante Eindringling kann nur Willy Fritsch sein, und das Traumpaar Harvey/Fritsch amüsiert fortan auf bewährte Weise. Dazu gibt es Musik von Friedrich Hollaender mit herrlich überdrehten Texten: "Ich laß mir meinen Körper schwarz bepinseln und fahre nach den Fidschi-Inseln." Auch eine mondäne "Negerbar" ist zu sehen, was der Ufa den Vorwurf der "Verniggerung" durch nationale Zeitungskritiker einbrachte.
-
‣17. - 24. September 1998. Arsenal: Die Aran-Inseln – Ein Filmmythos. Eine sechsteilige Filmreihe im Arsenal zu Robert Flahertys "Man of Aran" von 1934. – Die Aran-Inseln – Ein Filmmythos (1998).pdf – Robert Flaherty gilt mit seinem Filmen "Nanook of the North" (1922), "Moana. A Romance of the Golden Age" (1926) und "Man of Aran" (1934) als der "große alte Mann" des Dokumentarfilms. "Man of Aran", auf Inishmore, der größten der drei Aran-Inseln an der irischen Westküste gedreht, wurde schon von den Zeitgenossen kontrovers diskutiert: die einen lobten seinen dokumentarisch-poetischen Blick, andere kritisierten, daß er die sozialen Ungerechtigkeiten auf den Inseln ignoriert hätte. Seit Ende der 70er Jahre reisen immer wieder Filmemacher auf den Spuren Robert Flahertys auf die Aran-Inseln, auf der Suche nach einem Filmmythos. Sie bestätigen, daß Flaherty Anfang der 30er Jahre weniger an der rauen Insel-Realität interessiert war als vielmehr an der Umsetzung seiner romantischen Vorstellung eines ewigen Kampfes zwischen Mensch und Natur. So führten ihre Reisen fast zwangsläufig auch zu Rückfragen an das Genre des Dokumentarfilms. Die Dokumentaristen von heute haben zwar Flahertys poetischen Blick übernommen, verlieren aber nie ihre Chronistenpflicht aus den Augen und berichten über aussterbende Berufe, beinah leergefischte Meere, Auswanderung und Überalterung, aber auch über die Liebe zur Heimat, die Rückbesinnung auf fast vergessene Traditionen und die ständige Präsenz eines alten Films, der die Wahrnehmung der Aran-Inseln bis heute bestimmt. George Stoney gab 1978 mit How The Myth Was Made den Anstoß, sich genauer mit Flahertys Film, seiner Deutung des Dokumentarischen und der Insel-Realität zu beschäftigen. Zur gleichen Zeit suchte der Berliner Helmuth Kopetzky auf Aran Das Gold der Elfen (1977) und entdeckte einen unspektakulären und beschwerlichen Alltag. Beide Autoren fanden aber auch Zeitzeugen, wie Flahertys Hauptdarstellerin Maggie Dirrane, die sich noch gut an die Dreharbeiten erinnern konnten. Ebenfalls 1978 erforschte der Schweizer Dokumentarist Jean-Blaise Junod in Retour à Aran (1978) die besondere Faszination der kargen Inseln. Sebastian Eschenbach beobachtete 1995 in Looking For The Man of Aran, wie der Insel-Tourismus den durch Flaherty definierten Aran-Mythos aufgreift. In The Island where the Wind was Born (1995/96) blickt der in Lettland arbeitende schwedische Dokumentarist Carl Biörsmark vor allem auf die Kultur und die Schönheiten der abgelegenen Inselgruppe, während Axel Engstfeld in Der zweite Blick, Teil II: Aran - Von Viehhändlern und anderen Iren (1997) in detailgenauen Einzelporträts den Lebenskampf der Inselbewohner festhält. Bereits vor Robert Flaherty hatte 1928 der deutsche Schriftsteller Heinrich Hauser mit seinem auf Aran geborenen Kollegen Liam O'Flaherty auf den Inseln gedreht. Dieser Film, offenbar als Teil eines größeren Irland-Films gedacht, konnte jetzt im Bundesarchiv-Filmarchiv wiederentdeckt werden. Ebenfalls im Bundesarchiv-Filmarchiv wiederentdeckt wurde Die grüne Insel, ein Kulturfilm von 1935 über Irland, der auch die Auswanderung von den Aran-Inseln dokumentiert [konnte aber nicht gezeigt werden.] Ein Gegenstück zum traditionellen Kulturfilm bildet Heinrich Bölls Filmessay Irland und seine Kinder (1961, Regie: Klaus Simon). Diese Filmreihe bietet auch die Gelegenheit, mit den Aran-Inseln und ihren Bewohnern ein Stück Irland kennenzulernen - ein kleine, fast vergessene europäische Region mit einem ganz eigenen Gesicht, in das sich Robert Flahertys Dokumentarfilm "Man of Aran" wohl für immer eingezeichnet hat.
-
‣9. September 1998, Arsenal: Reihe FilmDokument, Nr. 13. WINDJAMMER UND JANMAATEN. DIE LETZTEN SEGELSCHIFFE (D 1930, R: Heinrich Hauser) + MÄNNER, MEER UND STÜRME. EIN FILM VON DER ROMANTIK UND DEM LEBEN AN BORD EINES SEGELSCHIFFES (D 1942, Bearbeitung: Werner Adomatis) – FD 13 Die letzten Segelschiffe Handout.pdf – Anfang 1930 segelte der Berliner Schriftsteller Heinrich Hauser (1901-1955) 110 Tage lang auf der Viermastbark "Pamir" der Reederei F. Laeisz von Hamburg nach Südamerika. Von dieser Reise brachte er nicht nur eine spannende Buchreportage, sondern auch den einstündigen Dokumentarfilm "Die letzten Segelschiffe" mit – ein "Dokument von seltener, photographischer Schönheit" (Hans Sahl). Hauser dokumentiert das alltägliche Leben der Matrosen, ihre harte Arbeit, die immer gleichen Handgriffe, die kleinen Freuden und die Augenblicke der Muße; er heroisiert nicht, auch nicht, als bei Kap Horn ein heftiger Sturm das Schiff erschüttert. Hausers einziger Held ist die "Pamir", die dunklen Maste und das helle Segelwerk. Sie bilden auch das Leitmotiv einer Sinfonie, die das Thema der existentiellen Erfahrung dieser Seereise variiert. Das Leben an Bord erscheint als ein seltsames Stadium außerhalb jeder Zeit, als eine Gegenwart ohne Anfang und ohne Ziel. Im Anschluß an "Die letzten Segelschiffe" von 1930 zeigen wir die Kulturfilmfassung "Männer, Meer und Stürme. Ein Film von der Romantik und dem Leben an Bord eines Segelschiffes", die 1942 vom Oberkommando der Kriegsmarine erstellt wurde. Diese auf zwanzig Minuten gekürzte, neumontierte und zum Teil kommentierte Tonfassung setzt mit der Betonung des Volkstümlichen und des Führerprinzips deutlich andere Akzente als Heinrich Hausers Originalfilm.
-
‣15. August 1998, Chapman University, USA. 10th Annual Society for Animation Studies Conference, 1998. Vortrag: Puppet Animation in Germany from 1915 to 1945 – Puppet Animation in Germany from 1915 to 1945 SAS Conference 1998 Handout.pdf.
-
‣31. Juli 1998, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 66. Sturmflut. Schicksal des Menschen – wie gleichst du dem Meere! (D 1927, R: Willy Reiber) – W 66 Sturmflut.pdf – Eine dramatische Liebesgeschichte, die sich während eines Sturms mit Windstärke 12 zuspitzt. "Der Film stellt zwei Liebespaare auf die Beine – zwei Liebhaber, die sich umbringen wollen, und garniert darum Seemannslos, Männerfeindschaft, Frauenhass, Vatertod, Dienertreue , Pfarrertrost." (Film-Kurier,1927). Im Vorprogramm die Emelka-Woche Nr. 2/1928 nebst Sonderdienste über eine Gas-Explosion in der Landsberger Allee und Versuche mit einem ferngelenkten Auto, ein Werbefilm für NSU Herr und Hund (D 1929, Gestaltung: Curt Schumann, Werner Kruse), Unerschütterlich (D 1928, Fischerkoesen-Film der Epoche; Fragment) und der Trailer zu Die Geliebte des Gouverneurs (D 1927, R: Friedrich Feher).
-
‣3. Juli 1998, Arsenal: Reihe FilmDokument, Nr. 11. Tönende Handschrift: Das Wunder des gezeichneten Tons – Handout – 1932 schuf der Trickfilmzeichner Rudolf Pfenninger (1899 - 1976) für die Münchner Emelka fünf Kurzfilme mit künstlichem Ton. Die "tönende Handschrift", wie Pfenninger seine Entwicklung nannte, beruhte auf der Überlegung, die in der Vergrößerung als Zacken erkennbaren Abbildungen des Lichttons nachzuzeichnen und so Töne und Klänge ohne Mikrophon herzustellen. Auf langen Papierollen zeichnete er eine Abfolge von genau berechneten Zacken, die er nach langen Vorstudien über den Zusammenhang zwischen den Ausformungen der Zackenschrift und Tonhöhe, Tonstärke und Klangfarbe ermittelt hatte. Diese Zeichnungen wurden abgefilmt und auf die Tonrandspur des Lichttonfilms aufgebracht. In dem Dokumentarfilm TÖNENDE HANDSCHRIFT, DAS WUNDER DES GEZEICHNETEN TONES (1932) interpretierte Pfenninger so das „Largo“ von Händel und begleitete auch zwei Puppentrickfilme (Gebrüder Diehl), einen Ballettfilm und einen Zeichentrickfilm mit diesen "Tönen aus dem Nichts". Ähnliche Experimente unternahmen 1932 auch Oskar Fischinger (ORNAMENT SOUND) und László Moholy-Nagy, dessen Film mit synthetischen Tönen leider verschollenen ist. In der Sowjetunion arbeiteten gar vier Forschergruppen an diesem Verfahren; erhalten ist der Zeichentrickfilm WOR (DER DIEB) (SU 1934) mit synthetischem Ton von Nikolai Voinov. In den vierziger Jahren wurde das Verfahren des handgemalten Tons von Norman McLaren wiederaufgegriffen. Weitere Filme des Programms: ZWISCHEN MARS UND ERDE (D 1925, R: Dr. F. Möhl), PITSCH UND PATSCH (D 1932, Rudolf Pfenninger R: Rudolf Pfenninger), SERENADE. AUS DER SERIE: "TÖNENDE HANDSCHRIFT" VON RUDOLF PFENNINGER (D 1932, R: Gebrüder Diehl), "BARCAROLE". EIN KURZTONFILM AUS DER SERIE: "TÖNENDE HANDSCHRIFT" VON RUDOLF PFENNINGER (D 1932, R: Gebrüder Diehl) und KLEINE REBELLION (D 1932, R: Heinrich Köhler).
-
‣1998, 10. Filmfest Dresden. Der Puppentrickfilm in Deutschland bis 1945
-
‣6. März 1998, Arsenal: Reihe FilmDokument, Nr. 7. DIE WUNDER DES FILMS (D 1928, R: Edgar Beyfuß) + FILM (DU MUßT ZUR KIPHO) (D 1925, R: Julius Pinschewer, Guido Seeber) + IM FILMATELIER (D ca. 1927/29, R: Hedwig und Gerda Otto) – Handout – "Das Wesen des Films ist Bewegung" - so beginnt diese dem unbekannten Kameramann gewidmete Dokumentation über die DIE WUNDER DES FILMS von 1928. Der Kulturfilmregisseur Edgar Beyfuß montierte dieses „Werklied von der Arbeit am Kulturfilm“, um einen allgemeinverständlichen Blick hinter die Kulissen der Filmproduktion zu gewähren. Die alltägliche, oft gefahrenvolle Arbeit der Kameramänner wird ebenso vorgestellt wie die besonderen Probleme etwa bei Tieraufnahmen oder beim Filmen im Operationssaal. Das von Egdar Beyfuß formulierte Ziel des Kulturfilms - schöne und nette Bilder einzufangen - bezeichnet eine wesentliche Differenz zum heutigen Dokumentarfilm. Im zweiten Teil von DIE WUNDER DES FILMS werden verschiedene Trickfilmverfahren erläutert. Wir sehen, wie Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahmen gemacht werden und beobachten die langwierige Herstellung von Zeichentrick- und Scherenschnittfilmen. Waren Walter Ruttmanns absolute Filme von Anfang der 20er Jahre noch handcoloriert, so eröffnen 1928 das amerikanische Technicolor-Verfahren und das deutsche Sirius-System faszinierende Ausblicke auf ein damals neues Filmwunder, den Farbfilm. Im Vorprogramm zwei kurze Werbefilme aus der Produktion von Julius Pinschewer: der für die Berliner Kino- und Photo-Ausstellung 1925 (Kipho) realisierte absolute Werbefilm FILM bietet einen von Guido Seeber tricktechnisch gestalteten Schnelldurchgang durch die Filmproduktion, während die Puppen der von Hedwig und Gerda Otto IM FILMATELIER (ca. 1927/29) die Herstellung eines Werbefilms proben.
-
‣27. Februar 1998, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 61. Hotel Adlon (BRD 1955, R: Josef von Baky) – W 61 Hotel Adlon.pdf – Episodenfilm über die Geschichte des berühmten Berliner Hotels. Der glanzvolle Aufstieg des Hotel Adlon im Kaiserreich bis zu seiner Zerstörung in den ersten Nachkriegstagen 1945 wird von Josef von Baky weniger als Firmengeschichte denn als Sittenporträt und Parabel auf die deutsche Geschichte inszeniert. [Programm fiel aus wg. Unspielbarkeit der Kopie]
-
‣2. Januar 1998, Arsenal: Reihe FilmDokument, Nr. 5. Erkundung eines vergessenen Genres – Puppenanimationsfilme von 1910 bis 1945. – FD 5 Puppenanimationsfilme von 1910 bis 1945 Handout.pdf – Die Entwicklung des Puppenanimationsfilms in Deutschland von etwa 1910 bis 1945. In ausgewählten Beispielen wird dieses von der Filmgeschichte weitgehend übersehene Genre in seinen verschiedenen Ausformungen und Stilen erkundet. Die Gebrüder Diehl waren bis in frühen 60er Jahre nicht nur die fleißigsten, sondern auch durch ihre Märchenverfilmungen stilbildenden Puppenanimateure; sie werden mit WUPP LERNT GRUSELN (D 1932, R: Gebrüder Diehl), MAX UND MORITZ (D 1941, R: Gebrüder Diehl) sowie dem Werbefilm ES WAR EINMAL... (1935, R: Gebrüder Diehl) vorgestellt. Weitere Puppenwerbefilme der 30er Jahre stammen von Hedwig und Gerda Otto und Wolfgang Kaskeline. Die phantasiereich beseelten Puppen des in Frankreich lebenden Polen Ladislas Starewitsch waren auch in Deutschland sehr populär; wir zeigen einen Ausschnitt aus WIE DIE TIERE GEGEN REINEKE FUCHS IN DEN KAMPF ZOGEN! (F, 1930er Jahre). 1933 experimentierte A. von Gontscharoff in HILFE, EIN LÖWE. Ein plastischer TRickfilm (D 1933) mit speziellen Knetfiguren. In JOHN BULL IN NÖTEN (D, ca. 1942) steht die Puppenanimation im Dienst der Kriegspropaganda. Im Studio Zlin setzte dagegen Hermina Tyrlova 1943 mit DER BRAVE SLIM – ABENTEUER EINES NIEDLICHEN KÄFERS neue bemerkenswerte Impulse. Weitere Filme: MESSTER-PUPPENFILM (AvT) (D, undat.), Marionetten (D 1922, Julius Pinschewer), DAS WETTERHÄUSCHEN (D 1929, R: Hedwig und Gerda Otto), KIRMES IN HOLLYWOOD. EIN PUPPENSPIEL (D 1930, R: Gerda Otto), DER BUNTE TAG (1936, R: Wolfgang Kaskeline), ferner der Handpuppenfilm AM RICHTIGEN FLECK (D 1943).
-
‣3. Oktober 1997, Arsenal: Reihe FilmDokument, Nr. 2. DAS KIND UND DIE WELT (D 1931, R: Eberhard Frowein) – FD 2 Das Kind und die Welt Handout.pdf – 1931 realisierte Eberhard Frowein den abendfüllenden Dokumentarfilm "Das Kind und die Welt" über die Entwicklung des Kindes in seiner alltäglichen Umgebung. Gezeigt wird, wie das Kind allmählich seinen Lebensraum erobert, erweitert und behauptet. Die versteckte Kamera beobachtet das Kind von den ersten Lebenswochen an bis zum Alter von acht Jahren, wo es zum ersten Mal den Schutz des Hauses verläßt und sich in den Strom der Großstadtstraße wagt. Viele Szenen sind aus der Sicht des Kindes gefilmt; mit eindringlichen Bildern und Montagen wird der großstädtische Lebensraum, hier insbesondere die Berliner Hinterhöfe, skizziert. Der Film entstand unter der wissenschaftlichen Leitung des am Psychologischen Institut der Universität Berlin lehrenden Psychologen Kurt Lewin – einer der bedeutendsten Psychologen dieses Jahrhunderts, der 1933 zur Emigration gezwungen wurde. Im Vorprogramm: ZEITPROBLEME. WIE DER ARBEITER WOHNT (D 1930, R: Slatan Dudow), der auch die Lebensbedingungen proletarischer Kinder dokumentiert.
-
‣26. September 1997, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 56. Pikante Filme der Kaiserzeit – W 56 Pikante Filme der Kaiserzeit.pdf – Frühe Filme mit "graziösen, interessanten, pikanten Damen in reizvollster Decostümirung" (sic!), wie sie zumeist nur auf sogenannten Herrenabenden gezeigt wurden, sind bisher von der Filmgeschichte schamvoll übersehen worden. Wir zeigen eine Auswahl solcher 'pikanter Films', die insbesondere von der Wiener Saturn-Film in ihrem "Atelier pour films picants" zwischen 1907 und 1912 hergestellt wurden: Skulpturwerke. Poses d'atelier pour sculpture (D 1908, P: Messter-Studio), "Beim Kunstmaler" (Archivtitel, ca. 1906/07), Der Traum des Bildhauers (AU 1907, P: Saturn. Atelier pour films piquants, Wien), Besuch beim Kunstmaler (ca. 1910), Das eitle Stubenmädchen (AU ca. 1907/08, P: Saturn. Atelier pour films piquants, Wien), Lebender Marmor (AU ca. 1907/08, P: Saturn. Atelier pour films piquants, Wien), Der Angler (AU 1907, P: Saturn. Atelier pour films piquants, Wien), "Saturn-Film-Produktionen" (Archivtitel) (AU/?? ca. 1907/08, P: Saturn. Atelier pour films piquants, Wien, sowie unbekannte Produktionsfirma), "Nach der Reitübung" (Archivtitel) (AT: "La belle Miranda", "La belle Miranda in ihrer Szene") (D ca. 1903, P: Oskar Messter), "Unbekannte Entkleidungsszene aus der Sammlung Messter" (Archivtitel) (D, ca. 1905), Wie sich der Kientop rächt (D 1912, R: Gustav Trautschold), Sklavenraub (AU 1907, P: Saturn. Atelier pour films piquants, Wien), Die Macht der Hypnose (AU, ca. 1907/08, P: Saturn. Atelier pour films piquants, Wien), Weibliche Assentierung (AU, um 1910, P: Saturn. Atelier pour films piquants, Wien), "Eine schwierige Behandlung" (Archivtitel) (ca. 1910).
-
‣5. September 1997, Arsenal: Reihe FilmDokument, Nr. 1. Ufa-Städtefilme der 1930er Jahre: Berlin, Danzig, Düsseldorf, Königsberg. – FD 1 Ufa-Städtefilme der 1930er Jahre Handout.pdf – KLEINER FILM EINER GROSSEN STADT, DER STADT DÜSSELDORF AM RHEIN (D 1935, R: Walter Ruttmann), DANZIG. LAND AN STROM UND MEER (D 1939, R: Eugen York), WARSCHAU (D 1936, R: Wilhelm Prager), KÖNIGSBERG (D, 1938, R: Paul Engelmann) sowie SCHNELLES, SICHERES, SAUBERES BERLIN (D 1938, Regie: Ernst Kochel).
-
‣30. Mai 1997, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 52. Der Staatsanwalt klagt an (D 1928 R: Adolf Trotz, Theodor Sparkuhl) – W 52 Der Staatsantwalt klagt an.pdf – "Der Staatsanwalt klagt an" ist ein Plädoyer gegen die Todesstrafe: Ein Staatsanwalt verstrickt sich in den Fall eines Menschen, der sich selbst bezichtigt, jemanden in Eifersucht erschlagen zu haben. "An Stelle des Rechtes zur Strafe wird die Pflicht zur Verzeihung proklamiert." (Hans Feld im Film-Kurier) Die Bauten stammen von Victor Trivas, dem Regisseur des pazifistischen Films "Niemandsland". Im Vorprogramm: Magnificent Berlin (GB 1929, 8') und Im Schatten der Weltstadt (D 1930, R: Albrecht Viktor Blum, 11').
-
‣28. März 1997, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 50. Kinder, wie die Zeit vergeht! (D1940, R: Georg Schubert) – W 50 Kinder, wie die Zeit vergeht!.pdf – Eine Zusammenstellung über "40 Jahre Film", nationalsozialistisch bereinigt. In einer Rahmenhandlung präsentiert Hans Adalbert Schlettow Wochenschau-Ausschnitte, Trick- und Kurzfilme von anno dazumal.
-
‣28. Februar 1997, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 49. Der Faschingskönig. Ein Spiel von Glücksrittern und schönen Frauen (D [DK] 1928, R: Georg Jacoby) – W 49 Der Faschingskönig.pdf – Eine Erpressergeschichte. Liebesbriefe einer verheirateten Frau fallen in die Hände eines schurkischen Notars, der als Preis für sein Schweigen die Schwester der Frau begehrt. "Faschingstreiben, lustiger Mummenschanz, Papierschneeballschlachten, ausgelassene Fröhlichkeit alkoholisierter Massen, blauviragierte Rivieranächte, Erzhalunken, unschuldige Mädchen und der dazu gehörende edle Mann, Kartenspiele und treue Liebe, Sensationen und ein gut erdachtes happy end." (Der Film, 1928) – Im Vorprogramm die Wochenschau Emelka-Woche 6/1928 (mit Beiträgen u.a. über den neuesten Polizei-Bild-Funk, einen berühmten Wiener Psycho-Graphologen, einen eigenartigen Verkehrsunfall sowie ein Münchner Künstlerfaschingsfest.
-
‣26. April 1996, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt Nr. 44 (zusammen mit Martin Loiperdinger). 100 Jahre Berliner Kino: Frühe Dokumentarfilme über Deutschland von Lumière, Messter und Pathé (F/D 1896-1914) – W 44 100 Jahre Berliner Kino.pdf – Vor 100 Jahren, am 25. April 1896, wurde in einem Raum der Gaststätte "Wilhelmshallen", Unter den Linden Nr. 21 das erste Berliner Kino eröffnet. Drei Tage später begann in der Friedrichstraße 65a Ecke Mohrenstraße der Cinématographe Lumière zu spielen, und schon kurze Zeit später folgte der Berliner Oskar Messter mit selbstgebauten Projektoren ins Filmgeschäft. Frühe Dokumentaraufnahmen aus Berlin und anderen deutschen Städten erinnern an den Geburtstag der Berliner Kinos.
-
‣16. November 1995, Martin-Gropius-Bau. Avantgarde und Experiment. Deutsche und russische Filmversuche der 20er und 30er Jahre. Vortrag zur Ausstellung "Berlin - Moskau"
-
‣10. November 1995, Bonn: Bonner Symposium zum Medien-Musik-Preis. Frühe Tonfilmexperimente und neue Film-Dramaturgien 1929/30
-
‣18. September 1995, Zeughauskino. Zum 100. Geburtstag von Karol Rathaus. Die Koffer des Herrn O.F. (D 1931, R: Alexis Granowsky) – Zum 100. Geburtstag von Karol Rathaus.pdf – 13 einsam reisende Koffer und die Buchung einer ganze Zimmerflucht im einzigen Hotel am Ort versetzen das verschlafende Ostend in einen wahren Taumel. Schnell geht das Gerücht, ein Milliardär werde erwartet, um sich niederzulassen, und das während der Weltwirtschaftskrise! Die Songtexte schrieb Erich Kästner, die Musik stammt von Karo! Rathaus und Kurt Schröder. Karo! Ratnaus erstellte auch die Musik zu Fedor Ozeps "Der Mörder Dimitri Karamasoff", der am 17.9. im Zeughauskino um 11:00 Uhr zu sehen ist. in Zusammenarbeit mit musica reanimata. Tänze und Chansons von Karol Rathaus aus Tonfilmen mit Annette Dasch (Gesang) und Gottfried Eberle (Klavier).
-
‣15. September 1995, International IAMHIST Conference Berlin 1995. WELTSTADT IN FLEGELJAHREN, EIN BERICHT ÜBER CHICAGO (1931, R: Heinrich Hauser)
-
‣15. September 1995, International IAMHIST Conference Berlin 1995. Workshop: "Ufa-City films, 1933-1945"
-
‣20. Juli 1995, Arsenal. Zum 100. Geburtstag von László Moholy-Nagy.
-
‣28. April 1995, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 35. Aufruhr des Blutes (D 1929, R: Victor Trivas) – W 35 Aufruhr des Blutes.pdf – Drei großstadtmüde Männer suchen in ländlicher Idylle die Utopie der freien Liebe. Ein Mädchen vom Zirkus verdreht gleich allen dreien den Kopf, doch als die Hahnenkämpfe ausgestanden sind, hat die 'Helena des Weekend-Krieges' (Deut. Zeitung Bohemia, 1929) längst ihr Bündel geschnürt. Vorprogramm: Vorwärts im neuen Berlin, 2. Teil: Berlin, wie der Fremde es sehen sollte... und vielleicht auch mancher Berliner - ! (1927)
-
‣24. Februar 1995, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 33. Der Kampf der Tertia (D 1928, R: Max Mack) – W 33 Kampf der Tertia.pdf – Eine Schulklasse erklärt der Bürokratie mit Witz und Raffinesse den Krieg, als ein klein-bürgermeisterlicher Beschluss die Tötung aller Katzen verlangt. "In "Der Kampf der Tertia", nach dem Roman von Wilhelm Speyer [Drehbuch: Axel Eggebrecht], zeigt Mack sich als geschickter Regisseur von jugendlichen Laiendarstellern, unterstützt von Kameramann Emil Schünemann, der die Außenaufnahmen im Watt stimmungsvoll fotografiert.« (Cinegraph) Max Mack tingelte zunächst als Schauspieler durch die Provinz, kam 1910 nach Berlin und drehte bald unzählige Kientopp-Produktionen für die junge Filmwirtschaft. Mack inszenierte Sketche und "prickelnde Lustspiele" oder Unheimliches wie "Der Andere". 1933 muß er emigrieren, im Exil gelingt es ihm nicht, wieder Fuß zu fassen. im Vorprogramm vergnügliche Trickfilme der 1920er und frühen 1930er Jahre, die der weitgehend unbekannte Kunstmaler Paul N. Peroff erst in New York, später in Berlin gezeichnet hat: Willi's Zukunftstraum. Eine Filmgrotreske (USA 1926). Santa Claus (D 1930), Die Meistersinger (D 1930) und Die Geisterschenke (D 1931).
-
‣5. November 1994, Arsenal. Vortrag zur Erstaufführung der Symphonie diagonale von Viking Eggeling im Jahre 1924. – Handout Symphonie diagonale vor 70 Jahren_1994.pdf – Am 5. November 1924 wurde die Symphonie diagonale des schwedischen Malers und Filmpioniers Viking Eggeling zum ersten Mal aufgeführt. Bei einer Privatvorstellung im Verein Deutscher Ingenieure waren u.a. El Lissitzky, László Moholy-Nagy, Arthur Segal, Ernst Kállai, Alfréd Kemény und Werner Graeff anwesend. Angekündigt als "neues künstlerisches Phänomen", als "optische Orchestration", ist dieser Film einer der radikalsten und formal strengsten Versuche, eine "Bewegungskunst" zu realisieren. Eggeling arbeitete mit "reinen", abstrakten Formen, deren Abläufe und Veränderungen er analog zur Musik gestaltete. In diesem "elementar-magischen" Sinn entzieht sich sein abstrakter Trickfilm jeder bildhaften Beschreibung und Deutung. Kinopremiere war am 3. Mai 1925 im Rahmen der berühmten Matinee "Der absolute Film", die erstmals in Deutschland einen Überblick über die Film-Avantgarde gab. Viking Eggeling starb einige Tage später, am 19. Mai 1925, im Alter von 45 Jahren. Zur Erinnerung an die Erstaufführung der Symphonie diagonale vor 70 Jahren wird der Film in verschiedenen Geschwindigkeiten mit jeweils unterschiedlicher Musikbegleitung gezeigt. Avantgarde-Filme von Walter Ruttmann (Lichtspiel Opus 2-4), Hans Richter (Ausschnitte aus 40 Jahre Experiment) und Fernand Léger (Ballet mécanique) ergänzen diese Hommage an einen der radikalsten Filmexperimentatoren der 20er Jahre. Am Klavier: Gottfried Eberle.
-
‣28. Oktober 1994, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 30. Bigamie (D 1927, R: Jaap Speyer; französische Exportfassung) + Werbefilme – W 30 Bigamie.PDF – Ein biederer Klempnermeister heiratet eine Vorstadttänzerin. Als sie spurlos verschwindet, wendet er sich einer alten Freundin zu. Mit einem gefälschtem Totenschein heiratet er sie und findet ein neues Glück - bis eines Tages seine erste Frau wieder auftaucht. Es kommt zum Prozeß wegen Bigamie und Urkundenfälschung. Vorprogramm: Emelka-Woche, Nr. 38, 1927 (D 1927), Werbefilme für die "Kieler Zeitung" und die "Ceres" Versicherung (D, 1920er Jahre, AvT), Die Geschichte vom Schokoladenkaspar (D 1926, Gestaltung: Julius Pinschewer, Animation: Hans Fischerkoesen), Der Weg zum Photographen (D ca. 1928), Werbefilm für Kleidung mit Mottenschutz (D nach 1927, AvT).
-
‣13. August 1994, Zeughauskino: Deutsche Kriegsanleihe-Werbefilme des Ersten Weltkriegs. – Kriegsanleihe-Werbefilme 13.8.1994 Handout.pdf – 1917/1 8 entstanden zahlreiche Werbefilme, die zum Zeichnen von Kriegsanleihen aufforderten. Zu einem Zeitpunkt, als der Werbefilm noch kaum entwickelt war, experimentierten diese Filme mit den unterschiedlichsten Genres und Stilmitteln, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu gewinnen und die Opferbereitschaft der Bevölkerung zu mobilisieren: Das Saugetier (D 1918), Kriegsanleihe-Werbefilme der Reichsbank, Teil 1-3 (D 1916-1918), Die brennende Wunde. Eine Geschichte aus unserer Zeit (D 1918, R: Karl Frey, Franz Seitz), Michel und Viktoria (D 1918, R: Carl Schönfeld), Kriegsanleihe-Werbefilm (Fragment).
-
‣29. Juni 1994, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 27. Wenn das Herz der Jugend spricht (D 1926, R: Fred Sauer) – W 27 Wenn das Herz der Jugend spricht.pdf – Ein berühmter, älterer Arzt heiratet eine wesentlich jüngere Frau, die er bald wegen seiner Arbeit vernachlässigt. Als sie einen Jugendfreund wieder trifft und die alte Liebe erwacht, gibt der Arzt sie frei.
-
‣29. April 1994, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 23. Die Insel der Träume (D 1925, R: Paul Ludwig Stein). – Wiederentdeckt 23 Insel der Träume.pdf – Ein Liebesabenteuer unter Fürsten und Bankrotteuren, in dem eine geheimnisvolle Insel in Russland eine Rolle spielt.
-
‣25. Februar 1994, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 21. Lockendes Gift (D 1928, R: Fred Sauer). – Lockendes Gift.PDF – Nach der englischen Romanvorlage "Sweet Pepper" von Geoffrey Moss drehte Sauer diesen geschickt gemachten, spannenden Gesellschafts- und Agentenfilm mit schönen Außenaufnahmen. Jill, Sekretärin im Außenministerium, verliebt sich in einen Angehörigen der ungarischen Botschaft. Erfreut nimmt sie einen Auftrag an, der sie nach Budapest führen soll, doch auf der Schiffsreise macht sie die folgenschwere Bekanntschaft eines Waffenschmugglers. leichtgläubig läßt sie sich auf dessen luxuriöses Umfeld in Budapest ein und gerät in Verdacht, die Geliebte des Verbrechers zu sein, doch zu guter Letzt kann sie ihre Unschuld beweisen. Nach vielen Turbulenzen hält der Film ein Happy End bereit.
-
‣4. Dezember 1993, Zeughauskino, 21.30 Uhr. Vortrag über Ernst Toller zu seinem 100. Geburtstag, mit unbekannten originalen Tondokumenten. Film: Pastor Hall (OF, GB 1940, R: Roy Boulting). Deutsche Erstaufführung. Ein britischer Propagandafilm nach einem Theaterstück von Toller, der sich um eine Differenzierung zwischen Opfern und Tätern im Feindesland Deutschland bemüht. Ein deutscher Pastor, angelehnt an die Person Martin Niemöllers, predigt gegen die Ideologie der Nazis und wird in ein Konzentrationslager verschleppt. – Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Akademie der Künste und der Stiftung Deutsche Kinemathek.
-
‣4. Dezember 1993, Zeughauskino, 19.00 Uhr. Vortrag über Erwin Piscator zu seinem 100. Geburtstag, mit unbekannten originalen Tondokumenten. Film: Wosstamje rybakov (OF; Der Aufstand der Fischer von St. Barbara, UdSSR 1934, R: Erwin Piscator). Erwin Piscators einzige Filmarbeit entstand in der UdSSR und ist ein Beitrag im Kampf gegen Hitler. Matrosen revoltieren gegen einen unmenschlichen Reeder. Den pessimistischen Schluß der Romanvorlage von Anna Seghers verwandelte Piscator in einen hoffnungsfrohen Aufruf für die Volksfront. – Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Akademie der Künste und der Stiftung Deutsche Kinemathek.
-
‣28. Mai 1993, Zeughauskino: Reihe Wiederentdeckt, Nr. 12. Madame X und die schwarze Hand (D 1921, R: Fred Sauer). – W 12 Madame X und die schwarze Hand.PDF – Ein moderner Sensationsfilm: "In spannendster Weise bringt die geschickt abgefaßte Handlung Szenen aus dem Verbrecherleben, die Verfolgung der Verbrecher, [...], rauschende Feste, fesselnde Szenenbilder der Zwangsarbeit, hervorragende Tierdressuren, hypnotische Szenen, Schädelforschung, Fakirkünste, Verfolgungen im Auto, zu Pferde, zu Wasser, usw. Die Handlung der sechs Akte ist wohl das Interessanteste, was seit langem auf dem Gebiet der Filmproduktion gezeigt wurde. Sie enthält alles, was dem Gesamtgeschmack der Zuschauer entspricht." (Der Kinematograph, Nr. 727, 23. Januar 1921)

Einführungen und Vorträge 1993/2009